Postpandemische Rettungsgasse Bildung
Man weiß und wusste, dass eine Gesundheitskrise dieses Ausmaßes die Gesundheitssysteme an den Rand ihrer Möglichkeiten bringen kann, dass sie in der Folge auch den Arbeitsmarkt und das Wirtschaftssystem
in die Knie zwingen kann, und dass sie zu guter Letzt auch im Sozialsystem tiefe Spuren, Risse und Narben hinterlassen würde. Ahnen konnte man das alles. Albert Camus hat in „Die Pest“[1] die Szenarien vorausgedacht und gar nicht so beliebig, sondern ziemlich treffend und drastisch vorausgedichtet. Ähnliches könnte nun zur gegenwärtigen Situation in der Ukraine gesagt werden, oder aber auch zu den zahlreichen Krisen zuvor und
die uns wahrscheinlich noch bevorstehen. Der ORF erkundet zurzeit die Befindlichkeiten einer sogenannten „Generation Krise“ und die Herausforderungen eines neuen Wirtschaftens und einer neu zu findenden Normalität im Hinblick auf Klimawandel klopfen lautstark an die Tür. Doch, warum sind wir nicht vorbereitet? Diese Krisen erscheinen trotz Propheten, Mahnenden und nicht zuletzt wissenschaftlicher Evidenz „urplötzlich“ in unserem Leben, unserem Alltag.
Ordnung – die Wendung der Not
Wie wir heute wissen, ist es nicht nur das Sozialsystem, dessen Strukturen und Prozesse dem Stress der Erosion der Pandemie ausgesetzt sind und waren, sondern viel mehr die alltägliche Sozialkultur, also jenes situativ und symbolisch interagierte Ordnungsmodell, in dem wir uns in alltäglich gedachten und verhandelten Begegnungen selbst eine Position, Status, Aufmerksamkeit, eine Rolle, meist auch Funktionen zumessen, in denen wir unsere Beziehungen denken und in denen wir uns selbst in der Regel und nach aller Regel identifiziert wissen.
Die „Strukturen der Alltagswelt“[2] sind, das wurde deutlich, nicht natürlich, sondern sie sind gemacht. Hinter dem Alltäglichen stehen gewohnte Erwartungen, die wir denken, weil wir sie als praktisch (emp-)finden; sie machen das Leben einfach, geben uns erst die Freiheit sich beständig mit den vielen (kleinen) notwendigen Entscheidungen auseinander zu setzen.
In einer Krise zu stehen, bedeutet somit sich nicht mehr auf die gewohnte „Einfachheit“ gelebter manifester Ordnung verlassen zu können, sondern diese hinter sich lassen zu müssen. Man steht dann wahrlich vor einem Scherbenhaufen und/oder inspirierenden Herausforderungen, an denen man für die Zukunft wachsen kann. Der Umgang damit, kann sehr unterschiedlich sein, doch der Wunsch eines zurück zur „Normalität“ ist etwas zutiefst Menschliches, wir fordern dies ein, kritisieren die, welche wir als Verantwortliche des „Schadens“ identifizieren und sanktionieren diesen Ordnungsbruch.
Ordnungen sind somit praktische Fiktionen zu denkbaren Gegebenheiten, sie sind das Bemühen des Menschen, sich der existenziellen Vorfindlichkeit wegen einer Referenz für eine Sinn-Deutung zu geben: „Der Mensch ist, um zu sein“[3] und um zu sein, bedarf es Interaktion und Kommunikation. Erst durch den sozialen Austausch, die Beobachtung der anderen und vor allem auch die Selbstbeobachtung durch die Augen anderer, gewinnen wir die notwendige Sicherheit und Bestätigung für unser Handeln – alles im Interesse der Konstruktion von Wirklichkeit und der Bestimmung von Relevanz[4]. Krisen stören die Verlässlichkeit dieser Zurechtlegungen.
Der Umgang mit Komplexität – Denken im Krisenmodus
Wie aber nun damit umgehen? Wenn Ordnung die menschengemachte Reduktion des Alltäglichen ist, so ist die Krise – wenn auch unerfreulich – der Modus, die Chance Dinge „neu“ zu gestalten. Ihre Abwesenheit in unserem Alltag nur dem historisch gewachsenen Erfolg sich bewährender Ordnungssystematiken – Wissen – zuzuschreiben.
Krisenmöglichkeiten und Krisen selbst wachsen mit dem Grad der Komplexität solcher Zusammenhänge. Krisen sind Kontingenzpotenzial[5]: Sie sind möglich, selbst dort, wo sie nicht notwendig sind. Im Alltag, oft unwahrnehmbar, handeln wir auch beständig in diesem Modus – kleine und kleinste Verbesserung von Abläufen unseres sozialen Alltages, etwa durch das wechselseitige Kennenlernen unserer Mitmenschen, das Bestehen von alltäglichen Situationen. All dies ist neu und verändert beständig unsere Ordnungen, unser Wissen – die Evolution sozialer Systeme[6]. Nicht die Dinge, nicht die Zusammenhänge (selbst) sind komplex, sondern die Logik bzw. der Modus, in dem wir sie beobachten, weil wir sie so denken und wie wir sie denken, auch tun[7]. Die Möglichkeiten, darüber hinauszugehen, die Dinge anders zu sehen und anders zu bewerten, liegen im Potenzial der Kommunikation: In diesem Sinne wäre Überraschung, das „kommunikativste“, möglicherweise das „eigentliche“, weil das krisensicherste Moment der Konstruktion von Wirklichkeit.
Krise als Chance
In diesen Rahmen gestellt, ist Komplexität ein Schlüsselbegriff einer Gesellschaft, die ihre Chancen in der Krise (als Anlass) der möglichen Veränderung sieht, ein Begriff, der den Charakter der Herausforderung von Bruchstellen und Veränderungen von sozialen und kulturellen Ordnungsmustern (sozialer bzw. kultureller Wandel) markiert[8]. Auf dem Prüfstein steht das Bild, das wir uns von uns und der Welt, in, aus und mit der wir leben, machen. Die Welt ist, wie wir sie denken[9]. Wir bilden sie, wie wir sie denken und wir denken sie, wie wir sie bilden.
Dieses Bild (diese Bilder, um den Wert der Diversität in diese Überlegung einzubinden) umschreibt jene Sphäre, in der wir „die Welt“ wissentlich schaffen (zum Gegenstand von Wissen machen: Bildung), um ihr Sinn abzuverlangen: Indem wir „die Welt“, die eben ist, wie wir sie denken, zum Gegenstand von möglichem Wissen machen, schaffen wir Wissen über die Art und Weise, in der wir die Welt denken und bilden.
Um es noch einmal zu betonen: Menschen machen Wissen, sie (re-) produzieren ihr Handlungspotential aus ihrer gemachten Erfahrung UND dem Austausch darüber. Wir lernen.
Bildung – das reflektierte Verhältnis zu sich und zur Umwelt
Bildung, so ergibt es sich wortwörtlich, ist die durch Kommunikation ermöglichte Konstruktion von Bildern, in der wir die Welt normativ, kritisch, empirisch und pragmatisch deuten: Wie sie sein sollte, worauf es ankommt, dass sie ist, wie sie sein könnte, wie wir sie erfahren und wie wir meinen sie tun zu können. Weil diese Welt in umwelttypischen Konturen zu denken ist – als natürliche, soziale, kulturelle und symbolische Welt, müssen auch die Dimensionen der Bildkonstruktion (wie verstehen wir Bildung?) umwelttypisch gezogen werden. Dem folgend kann man Bildung verstehen als jenes Bemühen und als jenen Habitus, in dem man (oder: als jenes Potenzial, mit dem man) in die Lage kommt und/oder in der Lage ist, sein Verhältnis zur Umwelt sinnrelevant zu deuten, zu klären, zu reflektieren und abzustimmen [10,11].
Dieses als Umwelt beschriebene gedanklich erstandene Bild von der Welt macht sich kenntlich in einem harmonisch abgestimmten Verhältnis von Wissen, Bewusstsein und Haltung gegenüber den natürlichen, den sozialen, den kulturellen, den symbolischen und inspirativen Werten von Welt. Deren Sinn zu verstehen, heißt dann, ihren Nutzen, ihr Erscheinen (Ästhetik) und ihren Wert (Ethik) für die Existenz-Gestaltung (das Leben) des Menschen in den Modalitäten von Wissen, Bewusstsein und Haltung glaubhaft zu machen.
Wissen ist ein strukturelles Moment von Bildung wie Bildung das Motiv von und für Wissen ist. Bewusstsein ist ein Moment von Bildung wie Bildung die Referenz für bewusst gewusste Haltungen ist. Das Medium, in dem sich Wissen, Bewusstsein und Haltung entfalten, ist Kommunikation. Nicht die zufällige oder belanglose Konversation, sondern der bewusst gesuchte, der sozial, ästhetisch und ethisch abgestimmte Modus von Beobachtung und Verstehen.
Kompetenz ist die intelligent verantwortete Soll-Bruchstellen-Haltung im Umgang mit den Routinen des Alltags zu Wissen und zur Bestimmung der Wirklichkeit von Welt[12], des Verhältnisses zu sich und zur Umwelt, des Umgangs mit sich und anderen, mit eigenem und anderem Wissen.
In diesem Sinne sind Bildung und Kommunikation einander bedingende Größen, einander stützende Chancenbegriffe, die das Mögliche wirklich und das Wirkliche möglich machen[13]. Und das besonders im Falle der Krise. Denn die Krise ist ja der Moment, in dem die Routinen des bisher Gedachten umgedacht werden wollen, weswegen es Sinn macht, „die Krise“ als Chance zu nutzen.
Nach der Krise: dem Lernen einen neuen Rahmen geben
Eben diese Erkenntnis der Notwendigkeit des Umdenkens wird in der so oft während der Pandemie gestellten Frage „Was lernen wir aus der Krise?“ zum Diktat des postpandemischen Handelns. Da tut sich ein weites Spektrum auf: Nähe unter den Bedingungen sozialer Distanz, Sehnsucht nach Aufmerksamkeit unter den Bedingungen von Vereinzelung und Vereinsamung, wechselseitig-soziale Wahr-nehmung unter den Bedingungen alltäglicher Nebenbei-Begegnung, Achtsamkeit unter den Bedingungen der Suche nach Zerstreuung, und so vieles mehr.
Soweit es die breite Bildungslandschaft betrifft, sind das aus diesen Bedingungen mitgenommene Lernerfahrungen, eben aus Umständen wie home-office, home-schooling, home-entertainment, remote-desktop. Technisch, wie man bemerkt, kann und konnte man den Einbruch der sozial-räumlichen Umgangsgewohnheiten kompensieren, irgendwie bildgleich simulieren. Aber eben: Nur simulieren. Die Kulisse wurde aufgestellt, die Rollen wurden gespielt. Und wieder: Eben gespielt, vereinzelt, abgeschieden und mittelbar nachgezeichnet, ohne das entsprechende Ambiente von Unmittelbarkeit und Resonanz beleben zu können.
Daraus lassen sich mindestens zwei – für den Bildungszusammenhang relevante – Postulate ableiten:
- Die Muster, in denen die Gesellschaft ihre soziale Kultur – die Deutungen von Soziabilität – referiert und reflektiert, ob nun organisiert oder zufällig-beliebig: Kommunikation, Interaktion, wechselseitige Wahrnehmung, Achtung und Beobachtung und andere Werte so genannter sozialer Kompetenz, sind das Um und Auf für die Sinn-Beschreibungen des individuellen Lebens: Identität, Persönlichkeit, Selbstbewusstsein, Selbstorganisation, Selbstachtung, Resilienz, Autonomie, Souveränität, und viele weitere Werte-Größen von life literacy[14].
- Das Muster, in dem die Gesellschaft sich bildet, weil und indem das Individuum lernt, ist deutlicher als dies derzeit geschieht, gesellschaftlich (sozial-interaktiv, partizipativ und im Interesse gesellschaftlicher Verwertung) auszuverhandeln. Um es kommunikologisch auszudeuten[15]: Der Diskurs (Lehren, Verbreiten, Verstreuen) von wirklichkeitsbeschreibendem Wissen braucht mehr Dialog (konstruktive Konfrontation von Unterschied und mit Unterscheidung), um die wissentliche Beschreibung mit wirklichkeitsbildendem Bewusstsein anzureichern. Erst dort erreicht man die Wertigkeiten von Kompetenz[16] bezogen auf Reichweite des Bildungsmanagements und im Interesse der (sozialen) Nachhaltigkeit der organisierten Bildungsbemühungen hieße dies: Der Bildung und dem Lernen einen „Sitz im Leben“[17] zu geben, was soviel heißt wie: in der Deutung (Interpretation) von Bildung und in den Formaten von Lernen) die sozial-gesellschaftlichen Lebenszusammenhänge der Lernenden (Familien, Peers, Arbeitsplatz, Communities, Milieus, Medien) in Lernumgebungen mit zu berücksichtigen. Das verlangt ein Umdenken der Kanons, der Rollen (Rollenerwartungen), der Verteilung von Funktion, der Zuordnung von Verantwortung. Genau das aber heißt: Die kritischen Momente des Denkens, Wissens und Tuns brauchen eine freie Spur im Strom der gesellschaftlichen Fortbewegung (Transformation) in jenem emanzipatorisch gemeinten Interesse: Üben wir laufend die Krise, um den Normalzustand bestmöglich auszuschöpfen zu können.
Entscheidungen: Aus der Krise für die Krise lernen
Nach diesem theoretischen Exkurs was möglich ist, im Alltag und in der Krise und das beides nur Handlungsmodi in unserem Umgang mit Gesellschaft, der konstruierten Wirklichkeit sind, bleibt nun noch ein Fazit und einen Wunsch zu formulieren.
Natürlich und menschlich verständlich erscheint die Möglichkeit durch neu denken Gesellschaft zu verändern fantastisch, und zwar in beiden Hauptlesarten des Wortes. Trotzdem ist es genau das, was alltäglich passiert und die Vielfalt verschiedenster gesellschaftlicher Zusammenhänge und Konstellationen produziert. Zugleich ist das, was diese Kulturen, diese parallelen Bilder von Alltag ermöglicht und stabilisiert, auch das was ihrer Veränderung entgegensteht. Der Mensch möchte in erlebter Sicherheit bestehen, auch wenn die Bedeutung davon individuell höchst verschieden ist.
Die wichtigste Lehre aus der Krise sollte somit sein, uns stets in Erinnerung zu rufen, was möglich ist, wenn es nur sein muss. Für die (zukünftige) Krise zu lernen, kann somit nur bedeuten, sein Rüstzeug, seinen Handwerkskoffer dafür bereitzuhalten: Beständig zu lernen.
Um sich dafür den Rahmen zu geben, bedarf es zweier Strategien:
- Bewusster kritisch nachzudenken, was passieren könnte. Ob man dabei auf bewusste Schwarzmalerei[18], defensiven Pessimums oder einfach Risikomanagement setzt, ist eine Wahl der Worte. Die moderne Gesellschaft ist verletzlich und es ist eine Frage der gesellschaftlichen Verfasstheit und Entscheidungsmechanismen für welche Risiken man sich entscheidet und wie man sich dafür absichert[19].
- Sich Gesellschaft bewusst zu machen. Wir machen die Welt, und zwar durch Kommunikation und Interaktion. Zu lange wurde im Umgang damit in den letzten Jahren dabei auf eine VUCA Perspektive reduziert, wie kann man als Einzelner auf die Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit reagieren und sich dabei zugleich einen Marktwert, einen USP erarbeiten. Ein gegenwärtiger Blick auf die Welt zeigt uns aber wie vernetzt und verdichtet unsere Lebenswelt nicht ist, eine einzelne Person, wie mächtig sie auch immer ist, kann ihren Willen nicht durchsetzen. Erst durch das koordinierte Zusammenstehen und Handeln verändert sich etwas.
Nun zum frommen Wunsch: Auch wenn dieser Beitrag – ersichtlich an seiner Sprache – theoretischer Natur ist, Bildung ist der Schlüssel für Veränderung. Um den Herausforderungen von Digitalisierung, gesellschaftlicher Transformation im Hinblick auf die Klimakrise, Wirtschafts- und Finanzkrisen oder dem wohl fälschlicherweise überwunden geglaubten bewaffneten Konflikt gegenüber treten zu können, bedarf es gesellschaftlichem Zusammenstehen in allen Lebenslagen. Dies ist nicht konfliktfrei, umso wichtiger wird es diese Krisen, diese Diskursräume nutzen zu können. Ein Bestandteil davon ist lustvoll streiten zu können, nicht des Streits wegen, sondern um zu neuen besseren Lösungen beitragen zu können. Wir freuen uns auf den Austausch.
Zum Fußnoten- und Literaturverzeichnis.
Über die Autoren:
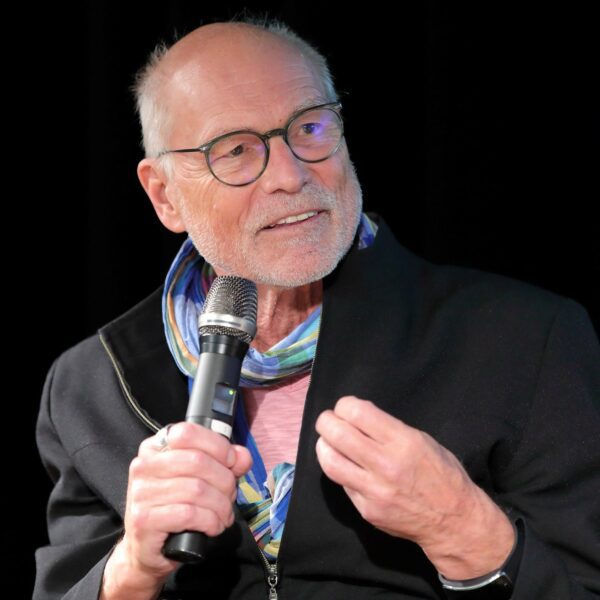 em. o. Univ.-Prof. Dr. Thomas A. Bauer ist emeritierter Professor der Universität Wien (Publizistik). Er entwickelte ein umfangreiches Forschungs- und Lehrprogramm im Bereich der Medientheorie & -bildung. Daneben setzt er sich für eine kritisch-reflexive Verknüpfung von theoretischer Analyse und innovativer Medienpraxis ein und war unter anderem Mitgründer von OKTO Community TV. Er ist Präsident der ESEC, die an der Verleihung des Erasmus EuroMedia Award als auch des Comenius EduMedia Award für herausragende Bildungsmedien beteiligt ist. Seine akademische Arbeit ist international ausgerichtet, und er hat ein umfangreiches akademisches Netzwerk aufgebaut.
em. o. Univ.-Prof. Dr. Thomas A. Bauer ist emeritierter Professor der Universität Wien (Publizistik). Er entwickelte ein umfangreiches Forschungs- und Lehrprogramm im Bereich der Medientheorie & -bildung. Daneben setzt er sich für eine kritisch-reflexive Verknüpfung von theoretischer Analyse und innovativer Medienpraxis ein und war unter anderem Mitgründer von OKTO Community TV. Er ist Präsident der ESEC, die an der Verleihung des Erasmus EuroMedia Award als auch des Comenius EduMedia Award für herausragende Bildungsmedien beteiligt ist. Seine akademische Arbeit ist international ausgerichtet, und er hat ein umfangreiches akademisches Netzwerk aufgebaut.

Mag. Michael-Bernhard Zita, Bakk. ist Projektmanager mit Erfahrung in EU-finanzierten Bildungsprojekten. Er hat Schlüsselkompetenzen im Bereich Kommunikationswissenschaft (Systemtheorie und Medienkompetenz) sowie in der Hochschulkursentwicklung. Berufliche Positionen: Senior Project Manager bei ipcenter.at, Redakteur bei mediamanual, Generalsekretär der ESEC und Teil des Vorstands der International Association of Public Media Researchers (IAPMR). Er arbeitet an seiner Dissertation (Publizistik) im Bereich der Herausforderungen und Bedingungen einer Digitalen Europäischen Öffentlichkeit.
Weitere Beiträge zu diesem Thema

Ob technikaffine Twens oder strukturierte Silver Worker: Teamgeist ist allen wichtig
26. Juni 2025
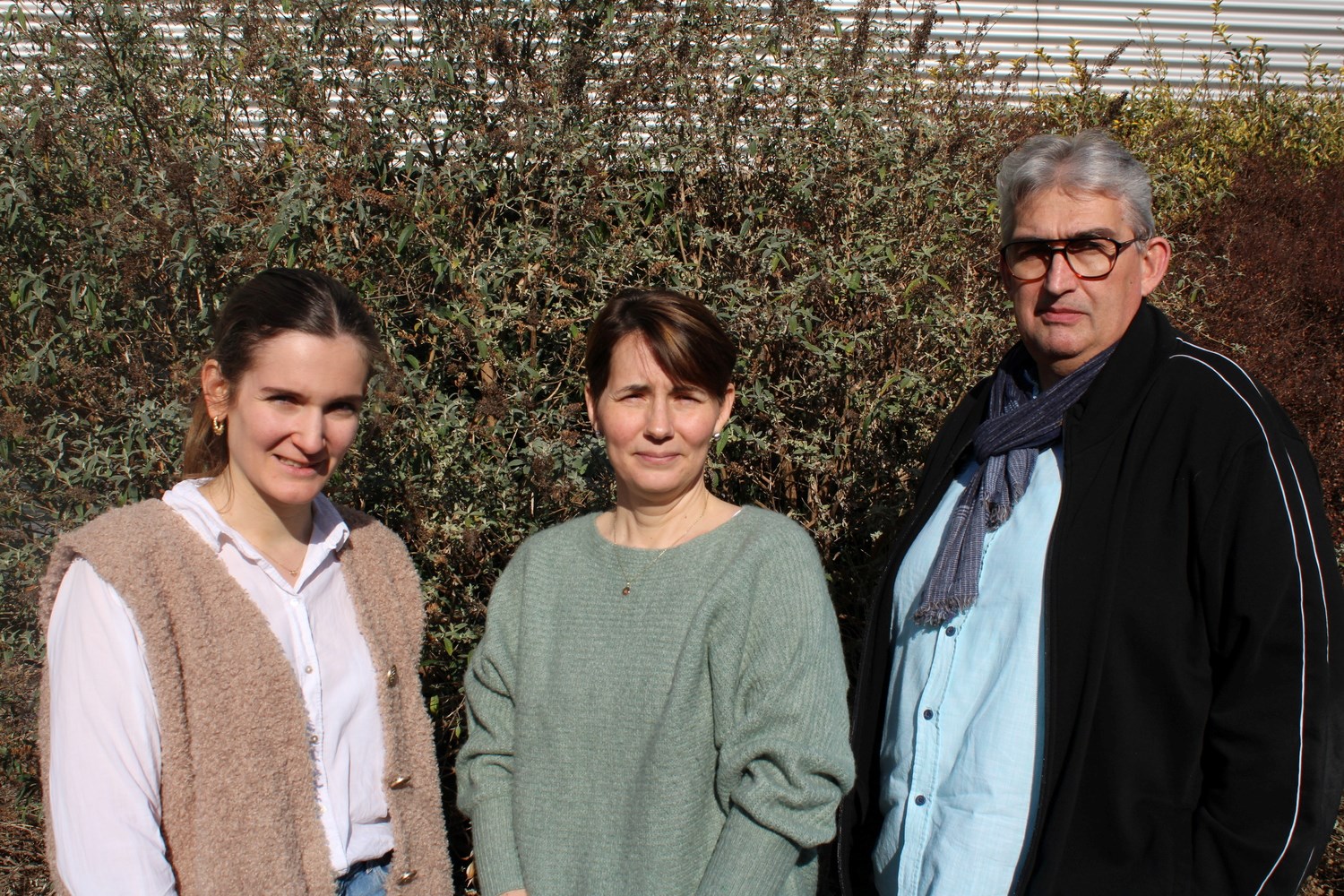
Auch Mülltrennung kann Bildung sein
6. März 2025

Outplacement: der Erfolg kommt mit der Vermittlung
12. September 2024

Dank viel Praxis denken Lehrlinge schnell wie Profis
6. Dezember 2023

