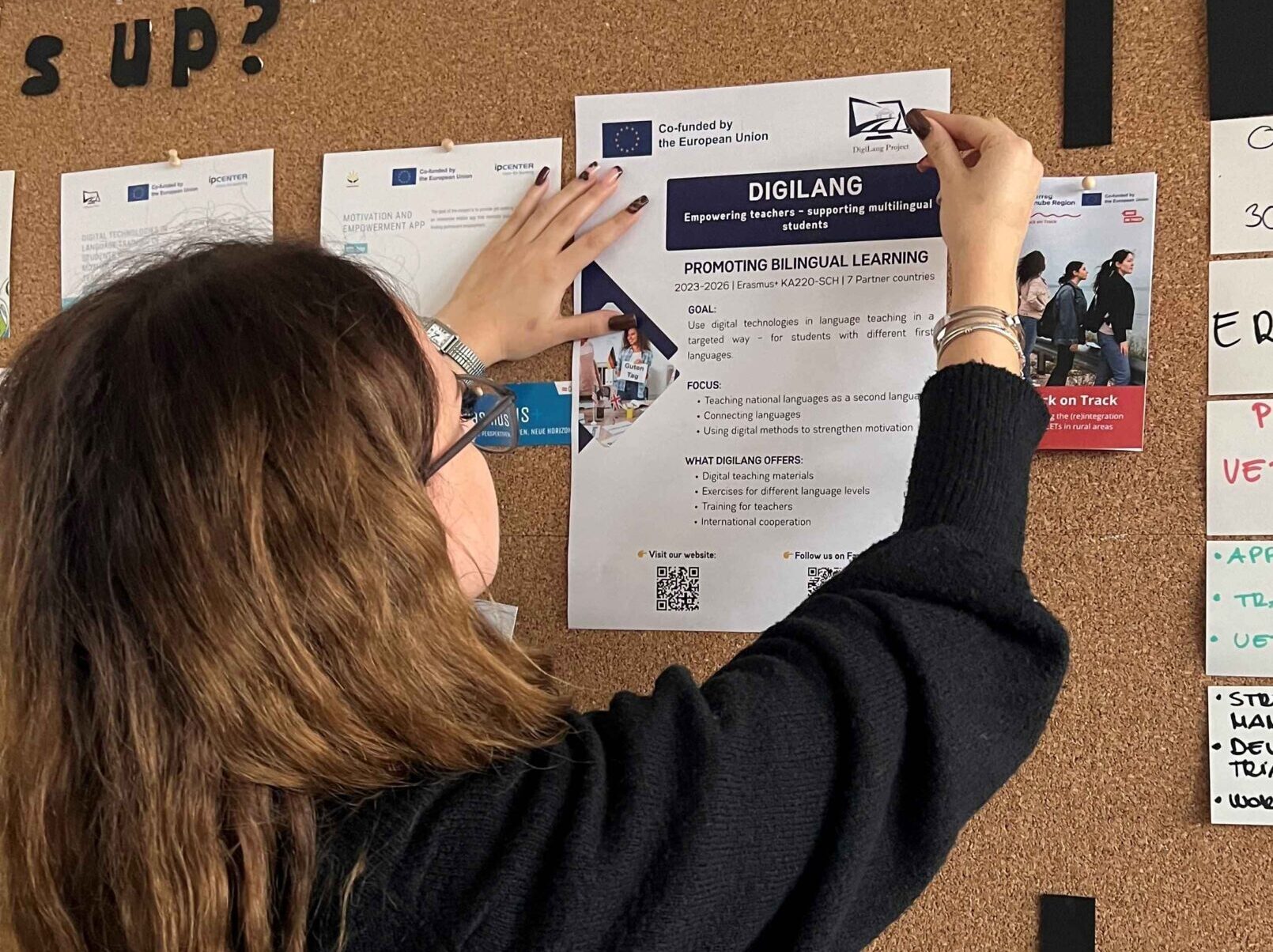Deutschlernen in Österreich: Chancen, Herausforderungen und Einflussfaktoren
Forschungsergebnisse aus dem DigiLang-Projekt
Sprache ist der Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe. In Österreich bilden Deutschkurse für Migrant:innen und Geflüchtete eine zentrale Grundlage für Integration, Arbeitsmarktchancen und soziale Vernetzung. Sie sind nicht nur Bildungsangebote, sondern auch Brücken zu einem selbstbestimmten Leben. Doch wie sind diese Kurse organisiert, und welche Faktoren bestimmen, ob das Sprachenlernen erfolgreich ist? Forschungsergebnisse aus dem DigiLang-Projekt liefern wertvolle Antworten.
Organisation der Sprachkurse
Der Großteil der Deutschkurse in Österreich werden von Arbeitsmarktservice (AMS) oder Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) finanziert:
- AMS-Kurse richten sich an arbeitslose Personen. Die Gruppen sind sehr heterogen – von Menschen ohne Schulabschluss bis zu Akademiker:innen, von EU-Bürger:innen bis zu Drittstaatsangehörigen.
- ÖIF-Kurse fokussieren auf Geflüchtete und Migrant:innen. Sie sind sprachlich homogener, häufig mit hohem Anteil arabischsprachiger Teilnehmender, daneben auch Paschtu, Dari/Farsi, Ukrainisch oder Somali.
Die Zusammensetzung der Gruppen beeinflusst maßgeblich Dynamik, Lernmethoden und Sprachpraxis im Unterricht.
Traumata als Lernbarriere
Viele Geflüchtete haben Krieg, Verfolgung oder Flucht erlebt. Studien zeigen, dass Depressionen, Angststörungen und PTBS in dieser Gruppe deutlich häufiger auftreten als in der Gesamtbevölkerung. Im Klassenzimmer zeigt sich dies in Konzentrationsproblemen, Vergesslichkeit, Panikattacken oder sozialem Rückzug.
Für die Sprachvermittlung bedeutet das:
- Sichere Lernräume sind entscheidend.
- Kontinuität bei Lehrpersonen verhindert Retraumatisierung.
- Akzeptanz individueller Bewältigungsstrategien stärkt das Vertrauen.
Der Umgang mit traumatisierten Teilnehmenden erfordert pädagogische Sensibilität und psychologisches Verständnis.
Motivation und Sprachpraxis im Alltag
Sprache lernt man nicht nur im Kurs. Wer Deutsch regelmäßig am Arbeitsplatz, mit Nachbar:innen oder durch Medien verwendet, macht deutlich schnellere Fortschritte.
Fehlt dieser Kontakt, droht Isolation. Besonders problematisch ist die Diskrepanz zwischen Standarddeutsch im Kurs und Dialekten im Alltag, was Motivation und Selbstvertrauen beeinträchtigen kann.
Bildungshintergrund als Schlüssel
Das Bildungsniveau in der Erstsprache wirkt sich direkt auf den Deutscherwerb aus:
- Höher gebildete Personen verfügen über Lernstrategien, Autonomie und oft Fremdsprachenkenntnisse. Sie lernen schneller und können beruflich an ihre Qualifikationen anknüpfen.
- Teilnehmende mit geringen Lese- und Schreibkenntnissen oder Analphabet:innen haben es deutlich schwerer. Ohne schriftliche Kompetenzen bleibt nur mündliches Lernen – ein systematischer Spracherwerb ist dadurch fast unmöglich.
Laut ÖIF hatten 2022 rund 70 % der Geflüchteten Alphabetisierungsbedarf, bei Männern sogar 84 %. Über die Hälfte der Teilnehmenden hat maximal Pflichtschulabschluss. Diese Lernenden bestehen Prüfungen wie A2 oder B1 deutlich seltener.
Stimmen aus der Praxis
Eine erfahrene Trainerin beschreibt Unterschiede zwischen AMS- und ÖIF-Kursen:
- AMS-Kurse: Mehr Stoff in kurzer Zeit, weniger traumatisierte Teilnehmende, mehr Sprachpraxis im Alltag.
- ÖIF-Kurse: Traumafolgen treten stärker hervor; viele können zu Hause kaum lernen.
Auch die Gruppenzusammensetzung spielt eine Rolle:
- Heterogene Gruppen halten Unterrichtssprache oft konsequent auf Deutsch.
- Homogene, arabisch dominierte Gruppen greifen häufiger auf Übersetzungen zurück, was Schwächeren hilft, aber andere entlasten kann.
Die Trainerin integrierte gezielt Mehrsprachigkeit:
- Neue Vokabeln wurden zunächst auf Deutsch eingeführt, dann in die Erstsprache übertragen.
- Maschinelle Übersetzungsprogramme unterstützten Minderheitensprachen.
Dieser Ansatz stärkte Motivation, festigte Inhalte und förderte das Sprachbewusstsein.
Fazit
 Deutschkurse sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Integrationspolitik in Österreich. Forschungsergebnisse des DigiLang-Projekts zeigen:
Deutschkurse sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Integrationspolitik in Österreich. Forschungsergebnisse des DigiLang-Projekts zeigen:
Traumata, fehlende Sprachpraxis, Dialektunterschiede und Bildungsniveau sind entscheidende Faktoren für Lernerfolg oder Misserfolg.
Sprachförderung muss weit mehr leisten als Grammatik und Vokabeln. Pädagogische Sensibilität, psychologische Unterstützung und gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die echte Sprachpraxis ermöglichen, sind entscheidend.
Nur so kann Deutschlernen zu einem Schlüssel für Teilhabe, Integration und neue Chancen werden.
Hinweis: Das Handbuch zu Methodik und Didaktik im multilingualen Klassenzimmer wurde im Rahmen des DigiLang-Projekts entwickelt und steht Trainer:innen auf Anfrage kostenlos zur Verfügung.
DigiLang wird aus Mitteln von Erasmus+ ermöglicht.
Mehr über das DigiLang-Projekt erfahren Sie hier:
🔗 DigiLang Projekt
Kontakt: Dr. phil. Dzenita Joldic | dzenita.joldic@ipcenter.at